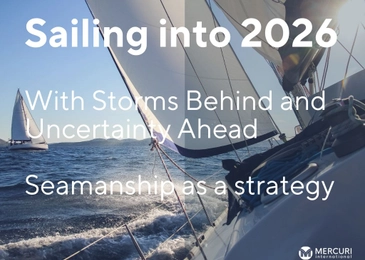Agilität ist mehr als ein Buzzword – richtig verstanden, bedeutet sie Anpassungsfähigkeit, Kundenorientierung und kontinuierliches Lernen.
In dieser Episode von „Ganz.Einfach.Vertrieb.“ spricht Marcus Redemann mit Alina Engel, Expertin für agiles Mindset und Coaching. Gemeinsam beleuchten sie, warum Agilität im Vertrieb heute so entscheidend ist – und wie Führungskräfte durch Coaching, Feedbackkultur und Vertrauen den Unterschied machen können.
Agilität ist mehr als ein Buzzword. Richtig verstanden, bedeutet Agilität Anpassungsfähigkeit, Kundenorientierung und kontinuierliches Lernen.
Darum steht im Zentrum dieser Episode die Frage: Frage: Wie gelingt es, Vertriebsteams flexibel auf Veränderungen einzustellen, ohne Chaos zu erzeugen – und dabei die Kundinnen und Kunden wirklich in den Mittelpunkt zu stellen?
Ein zentraler Aspekt dabei, ist die Rolle der Führungskraft als Coach. Wer es schafft, Mitarbeitende durch Fragen, Feedback und psychologische Sicherheit zu weiterzuentwickeln, statt nur Lösungen vorzugeben, fördert Eigenverantwortung und Innovation.
Die Folge liefert praxisnahe Einblicke und zeigt, wie systemisches Coaching im Vertriebsumfeld funktioniert. Natürlich darf dabei das Thema künstliche Intelligenz für Coaching und Weiterbildung nicht fehlen.
Weitere Podcasts & Whitepaper zu *Sales Excellence* und Agilität: https://mercuri.de/insights
Die aktuelle Mercuri-Studiezu Vertriebsstrategien und Kompetenzen: https://mercuri.de/insights/sommerstudie-2025-vertrieb-im-stimmungstief/
Jetzt reinhören und erfahren, wie Agilität, Coaching und kontinuierliches Lernen den Vertrieb zukunftsfähig machen!
Abonnieren Sie den Podcast einfach über die Plattform Ihrer Wahl:

ABONNIEREN SIE DEN PODCAST HIER FÜR IHR IPHONE ODER IPAD

ABONNIEREN SIE DEN PODCAST HIER FÜR IHRE ANDROID GERÄTE

ABONNIEREN SIE DEN PODCAST HIER AUF SPOTIFY
Ihre Informationsquelle zu aktuellen Themen im Vertrieb: https://mercuri.de
Euch hat die Episode gefallen? Dann gebt uns doch bitte eine 5-Sterne Bewertung und abonniert den Vertriebs-Podcast von Mercuri International. Über detailliertes Feedback freuen wir uns genauso. Schreibt einfach an: info@mercuri.de So können wir unseren Podcast weiter verbessern und die für Euch relevanten Inhalte präsentieren.
Gemeinsam können wir weiter die für Sie relevantesten Inhalte entwickeln.
Herzlich willkommen zum Mercuri-Podcast. Ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb. Mein Name ist Marcus Redemann und ich freue mich besonders auf diese Episode unseres Mercuri-Podcasts. Ganz einfach Vertrieb, denn wir haben eine Rekordhalterin zu Gast. Alina Engel ist da und sie ist bereits zum dritten Mal bei uns hier im Podcast. Und damit herzlich willkommen. Alina, wie fühlt man sich denn so als Rekordhalterin? Ach, tiefenentspannt. Ich freue mich immer wieder hier zu sein. Ja, uns freut es auch, liebe Alina. Denn du bist ja ausgewiesene Expertin für Themen wie Weiterbildung, Coaching, alles das, worüber sich wieder aktuell zu sprechen lohnt. Denn wir werden über das Thema Agilität, Coaching, Weiterbildung im Vertrieb sprechen. Aber zunächst stelle ich den Hörerinnen und Hörern doch einfach noch mal ein bisschen vor. Vielleicht haben Sie ja die ersten beiden Podcasts von dir nicht gehört. Ja, sehr gerne. Du hast das schon sehr gut auf den Punkt gebracht, was mich so umtreibt. Ich schreibe im Moment an meiner Doktorarbeit zum Thema Agiles Mindset. Das heißt, das Thema Agilität ist ein ganz großes. Ich bin tätig als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer öffentlichen Hochschule, Leite als Head of Academy, den Weiterbildungsbereich bei einem privaten Bildungsträger, wo wir unter anderem auch eine Weiterbildung im Bereich IT Sales anbieten und in Geschäftsführerin einer Coaching-Agentur im pädagogischen Bereich. Also mich beschäftigen die Themen Agilität, Agiles Mindset und persönliche Weiterentwicklung. Also alles Themen auch mit Blick auf die Zukunft, die relevant sind oder noch relevanter werden. Was auch unsere aktuelle Studie gezeigt hat, denn wir haben international gefragt, was denn so die Topthemen sind, insbesondere mit Blick auf die Kompetenzen im Vertrieb. Und ja, es gibt natürlich so ein paar Klassiker, wie Vertrauensbilden sich für den Kunden interessieren, aber neugierig bleibt oder neugierig sein sind so Themen. Aber in der Studie wird auch klar, dass der Vertrieb sich auch mit den Themen Weaskilling und Upskilling, wie es immer so schön heißt, beschäftigen sollte. Und in dem Zusammenhang taucht ja ein Thema auf, was dann auch sehr stark mit deiner Doktorarbeit zu tun hat. Der Vertrieb muss agiler werden. Daher erst mal eine grundsätzliche Frage, Nina, was heißt eigentlich agiler werden? Agilität ist ja so ein Stück weit auch ein Buzzword und vielleicht auch ein bisschen abgenutzt. Ursprünglich kommt der Begriff ja aus der Softwareentwicklung. Das heißt, in der Softwareentwicklung lebt man oder begibt sich in ein sehr dynamisches Umfeld und es geht dabei darum, sehr schnell auf sich verändernde Rahmenbedingungen reagieren zu können. Und dadurch ist eigentlich der Begriff der Agilität entstanden. Meint also ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit, eine ganz starke Kundenzentrierung und der Fokus darauf, kontinuierlich zu verbessern, kontinuierlich besser zu werden. Und am Ende bringt uns das dazu, dass wir eben auch unter Unsicherheit, wenn sich das im Außen so schnell ändert, die Rahmenbedingungen sich vielleicht verändern, trotzdem handlungsfähig bleiben. Und wenn wir eben Agilität leben, so wie es gedacht und gemeint ist, dann führt uns das genau dazu, dass uns eigentlich eine Veränderung im Außen nicht mehr viel anhaben kann, weil wir dazu in der Lage sind, darauf schnell zu reagieren. Das heißt also so ein Stück weit nämlich mit anpassungsfähig bleiben oder werden, egal was von außen auf einen eindringt. Und was heißt das genau für den Vertrieb, also Agilität im Vertrieb, wie kann man das greifen? Auch im Vertrieb ist es ja so, dass sich viele Dinge sehr stark verändert haben in den letzten Jahren und es auch weiterhin tun. Also einmal weg von vielleicht linearen Vorgehensweisen, von planungsintensiven Prozesten hin zu kürzere Interaktionen, wo man einfach schneller reagieren darf, von linearen Vertriebsmodellen zu mehr hybriden Vertriebsmodellen, Remote Work, Online und vor Ort beim Kunden. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Dinge, auf die wir reagieren dürfen. Und auch da bedarf es eben kurzen Iterationen, schneller Reaktionen, das heißt Prozesse in überschaubare kleine Schritte zu unterteilen, schnell Feedback einzuholen, auch vom Kunden, schnell auf veränderte Wünsche des Kunden reagieren zu können und idealerweise den Kunden eben direkt mit zu integrieren in den Prozess, auch als Team immer wieder auf neue Erkenntnisse reagieren zu können, ohne dass das Ganze im Chaos endet. Und letzter Instanz auch einfach schnell ein Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Also nicht erst am Ende eines langen Prozesses, sondern dass auch für den Kunden frühzeitig ein echter Mehrwert geboten werden kann. Was kann ich denn tun, also gerade als Unternehmen, auch wenn man mal diese Perspektive annimmt, damit Agilität genau diese Effekte wie Mehrwert für den Kunden schnelle Anpassungsfähigkeit und so weiter auch bringt und dass nicht jeder für sich interpretiert nach dem Motto, „Nah, dann kann ich ja machen, was ich will. Ich hauptsächlich nenn es Agil sein.“ Ja, ich glaube, das ist die größte Kritik an der Agilität, dass das Ganze schnell in Chaos enden kann. Insofern spreche ich gerne von einer strukturierten Agilität. Also strukturiertes Chaos dann. Na ja, so wie du es betrachten möchtest, redet mein Sohn auch über sein Kinderzimmer. Ich glaube, in der Agilität geht es darum, dass wir zum einen agile Prozesse aufsetzen, also dass uns nicht prozessuale Schleifen gefangen halten, sondern wir auch in unserem Standardprozess die Möglichkeit haben, schnell zu reagieren. Das bedarf auch eine organisationale Agilität. Also dass wir eben auch in unserer Organisation dafür sorgen, dass die Hierarchiestufen vielleicht durchlässig sind. Oder dass wir schnell reagieren können, auch einen schnellen Austausch über Bereichsübergreifend schaffen. Das kann zu organisationale Agilität beitragen. Und dann ist es auch ganz viel ein Verhaltung. Weil, ich sag mal, eines der Kernelemente von Agilität ist ja zum Beispiel Feedback, der Umgang mit Feedback, schnelles Einarbeiten von Feedback, schnelle Reaktion darauf. Und gerade wie in Deutschland sind nicht unbedingt dafür bekannt, dass wir sehr gut damit umgehen können oder eine gute konstruktive Feedbackkultur haben. Ja, und das ist etwas, da kann ich noch so viele Prozesse schaffen oder Organisationen anpassen. Am Ende hat es ganz viel damit zu tun, was ich auch als Führungskraft für eine Haltung mit reinbringe. Und wenn ich Fehler zulasse, aber gleichzeitig sage, na ja, trotzdem sollte ein Fehler halt einmal passieren und nicht dreimal, dann sind das die Elemente, die in der Summe dazu führen, dass ich eine strukturierte Agilität bekomme und nicht alles im Chaos mündet, wo jeder das macht, was er möchte. Nicht zuletzt, weil Agilität auch Team bedeutet. Also Kollaboration und Teamarbeit ist ein ganz großer und wichtiger Faktor, der auf Agilität einzahlt, vom Weg von diesem Einzelzentrum hin dazu, dass wir kollaborativ zusammenarbeiten. Ja, und dann ist das kein Chaos. Mir gefällt schon mal, dass dein Sohn so eine positive Sprache mit in sein Leben integriert, wie strukturiertes Chaos und ähnliches. Bin ich schon mal sehr sympathisch. Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, Feedback. Das geht ja in beide Seiten. Also ich muss als Führungskraft natürlich schauen, dass ich die richtigen Momente und Situation und Gelegenheiten für Feedback erkenne, aber natürlich auch auf der anderen Seite die Mitarbeitenden natürlich auch offen für das Feedback sein. Also es muss ja irgendwo um beiden Seiten sein und sollte ja nicht in Verteidigen der Position oder der Sachen, die man gemacht hat, ausarten. Weil dann kommen wir da sicherlich nicht weiter und das Thema Agilität ist dann schnell zum Scheitern verurteilt. Aber ja, die Führungskräfte sind ja die Treibenden in dem ganzen Stil. Was können die denn noch tun? Was kann die jetzt Führungskraft tun? Welche Rolle sollte ich einnehmen, damit Agilität im Vertrieb dann auch gelingt? Zudem, was du gerade gesagt hast, ein Punkt noch. Beim Feedback geht es nicht um Recht haben, sondern um besser werden. Und wenn ich mit dieser Haltung Feedback gegenüber trete, sowohl als Mitarbeiter als auch als Führungskraft, dann kann ich da ganz anders mit umgehen. Weil es geht nicht darum, dass einer Recht hat und der andere falsch liegt, sondern wie können wir aus den Ideen, die wir haben und aus unseren gemeinsamen Stärken das Beste rausholen. Und ich glaube, das ist auch die Haltung, mit der wir als Führungskraft in diese Agilität gehen. Das heißt, diese agilen Werte vorzuleben und diese Haltung mitzubringen. Also was kann das bedeuten? Das kann bedeuten, dass ich viel mehr und vielleicht auch den ersten Schritt mache in Richtung Transparenz, Erkenntnisse teilen anstatt die für mich zu behalten, damit ich vielleicht die besseren Zahlen erreiche, Austausch schaffen unter Mitarbeitern innerhalb des Teams und auch bereichsübergreifen, damit alle von diesen Erkenntnissen profitieren können. Best Practice Sharing auch mal erzählen, wenn was nicht so gut gelaufen ist und was konnte ich daraus mit dem, was konnte ich daraus lernen. Netzwerken, sowohl intern als auch darüber hinaus. Also alles, was in Richtung Teamorientierung und Kollaboration wirkt, ist etwas, was Führungskräfte nicht nur fördern sollten, sondern insbesondere auch vorleben dürfen. Darüber hinaus diese wirklich radikale Kundenzentrierung und dabei aber authentisch. Nämlich, dass ich wirklich versuche, den Kunden in meinen Entwicklungsprozess, in meinen Vertriebsprozess frühzeitig mit einzuintegrieren. Dieser Trend, den wir im Vertrieb beobachten können, von Kundenwissen steht über Produktwissen. Also ich will den Kunden wirklich so gut kennen, dass ich ihn sehr früh integrieren kann und die Erkenntnisse über ihn integrieren kann. Dann dieser Inspect and Adapt Ansatz. Also wenn etwas nicht funktioniert, dann auch nicht irgendwie dabei zu bleiben, weil man das einmal so definiert hat, sondern zu lernen, mitzunehmen und anzupassen. Und insbesondere der letzte Punkt, auch als Führungskraft Feedback, sei es vom Kunden oder vom Mitarbeitern, radikal ernst zu nehmen und nicht zu belächeln, sondern eben wirklich zu reflektieren und gegebenenfalls einzufassen, was davon können wir nehmen. Ich glaube darüber hinaus, dieses Thema Fehlerkultur oder nenn es vielleicht lieber Feedbackkultur, ist auch etwas, das kann ich noch so oft predigen, wenn ich es nicht selber vorlebe. Also wenn ich es nicht schaffe, als Führungskraft auch über meine faux pas zu sprechen, auch mal zu erzählen, wo etwas nicht so gut geklappt hat. Wenn es mir nicht gelingt, ein Umfeld zu schaffen, in dem keine Angst herrscht, sondern die Leute zugeben können, wenn was nicht geklappt hat und was sie daraus gelernt haben, dann kann ich davon noch so oft reden, das wird nicht passieren. Also das Thema psychologische Sicherheit im Team zu stärken, dafür zu sorgen, dass wir uns trauen Fehler zu machen, um daraus innovativ agieren zu können. Und wie du schon eingangs sagtest, mit Neugier nach vorne gehen zu können. Das sind alles Aufgaben, die ich als Führungskraft habe, die nicht so einfach sind, wie sie sich manchmal anhören, wenn wir da so drüber sprechen. Ja, ich glaube nicht so schnell gehen. Also wenn ich jetzt überlege, okay, wir machen das jetzt so und übrigens, ich gebe jetzt mal einen Feder zu. Jetzt geht nicht auch mal einen Feder zu. Also so leicht wird es ja nicht sein, sondern das ist ja dann ein Prozess dabei. Was sind denn deine Erfahrungen? Wie lange dauert so was, was passiert in diesem Prozess alles noch? Ja, absolut. Das ist ein Prozess, diese Haltung überhaupt zu entwickeln. Hat ganz viel damit zu tun, wie viel Vertrauen, was immer seit Jahren Nummer eins in allen möglichen Umfragen ist, Vertrauen geben, Vertrauen entwickeln. Wie sehr kann ich mir selber vertrauen? Ich traue mich zuzugeben, wenn was nicht gut gelungen ist. Und natürlich fängt das im Kleinen an und irgendwann traue ich mich vielleicht auch mehr. Häufig ist es ja so bei Führungskräften. Ich weiß, dass das wichtig ist und mir ist wichtig, dass meine Leute mir ihre Fehler zugeben oder mir gegenüber die Fehler zugeben, aber dass ich den ersten Schritt gehen muss. Dass ich vielleicht zuerst mal erzählen darf, wo ich es echt versammelt habe. Das fehlt so häufig. Und deswegen, es ist ganz viel meine eigene Entwicklung agileres Mindset, agilere Haltung, offener Haltung, die überhaupt ermöglicht, dass es im Team Veränderung geben kann. Veränderung ist ja noch ganz wichtig. Also diese Offenheit gegenüber Veränderungen, ist glaube ich etwas, so sagt es ja, in Deutschland ist Feedback-Kultur nicht so ausgeprägt, aber auch das Thema Offenheit gegenüber Veränderungen, ist glaube ich auch nicht das, was man uns sofort als Stärke zuschreibt. Kannst du uns da noch Hinweise geben, wie man den Prozess, diese Offenheit, sich zu verändern, weiterzuentwickeln, wie man das auch stärker unterstützen kann? Ja, absolut. Auch hier gibt es ja diesen Satz, der mittlerweile vielleicht auch ein bisschen oft gesagt wurde, aber Change ist the only constant. Das ist natürlich so. Das heißt, dieses Thema Veränderung nicht mehr als was Besonderes zu sehen. Oh, wir haben eine Veränderung, jetzt brauchen wir ein Change Management Team, die diese Veränderung treiben, sondern zu sagen, Veränderung findet jeden Tag statt. Und jeder von uns in diesem Team ist ein Stück weit Change Manager. Und wenn wir so auf Veränderung betrachten, im Sinne von das ist das, was wir jeden Tag machen. Wir verändern uns jeden Tag. Wir verändern die Prozesse hier jeden Tag. Wir bringen Veränderung für den Kunden jeden Tag. Dann bekommt diese Offenheit eine Natürlichkeit und eine Authentizität, mit der es mir viel besser gelingt, damit umzugehen, wenn die auch mal ein bisschen größer ist, diese Veränderung. Das kann auch bedeuten, einfach mal Experimente einzugehen. Wenn wir einen Prozess verändern, wenn wir etwas Neues auszuprobieren, einfach zu sagen, okay, lasst uns eine Hypothese formulieren, dass wir uns mal mit einer kleineren Zielgruppe anfangen und das testen. Und dann schauen wir, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn es funktioniert, wunderbar, dann skalieren wir das Ganze. Und wenn es nicht funktioniert, dann lass uns darüber reden und daraus lernen. Und diese Haltung, wo wir, wie du sagtest, gerade in Deutschland, da nicht unbedingt Vorreiter sind, auch das ist etwas, was ich als Funguskraft treiben kann. Und es muss nicht im Chaos münden, was dann ja wieder eine Kritik ist, die wirken kann. Weil ich kann am Ende, gerade wenn ich diesen Prozesseinhalte, die Hypothese zu formulieren, zu testen und dann zu validieren, kann ich ja sehr datenbasiert darauf entscheiden. Und deswegen ist Agilität in meinen Augen, wenn man sie so lebt, wie wir das hier gerade besprechen, weit weg davon im Chaos zu münden, sondern einfach eine Möglichkeit, sehr innovativ nach vorne zu gehen. Ja, man spürt schon, Alina, dass Agila werden jetzt nicht einfach so von oben herab verordnet werden kann, sondern das ist eine Kompetenz, die sich entwickeln muss. Der einen Seite bei den Mitarbeitern, den anderen zu entwickeln, aber auch die anderen zu entwickeln. Und in dem Zuge wird hier auch gerne das Thema Coaching genannt. Also die Führungskraft als Coach, die dann auch hilft, jetzt so eine Kompetenz wie Agila werden zu unterstützen, aber natürlich auch andere Kompetenzen weiterzuentwickeln. Wie siehst du denn die Rolle von Coaching im gesamten Zusammenhang besser werden, weiterentwickeln, stärker werden? Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Die Führungskraft als Coach generell, deswegen würde ich da gerne differenziert draufblicken. Führungskraft als Coach bedeutet für mich, dass die Führungskraft nicht hier reichisch oder autoritär von oben vorgibt, und den Mitarbeitenden den Weg freimacht. Und das ist eine Veränderung, die wir aber schon seit Jahren erleben, das heißt, das ist auch kein neuer Trend mehr. Die Aufgabe einer Führungskraft in dem Zusammenhang ist ja insbesondere das, warum zu vermitteln und das, was und das, wie den Mitarbeitenden zu überlassen. Und auch das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, weil ich mir als Führungskraft in der Vergangenheit vielleicht gerne so ein Kontrollfeld aufgebaut habe, in dem ich nicht nur das „Warum“, sondern insbesondere das „Was“ und das „Wie“ vorgebe. Und jetzt eben, ja, mich ein Stück zurücknehmen darf und sagen darf, ich bin dazu hier, die Vision zu vermitteln, die Richtung vorzugeben, den Mitarbeitenden zu ermöglichen, dass sie sich selbst organisieren können, Hindernis aus dem Weg zu räumen. Und über diese Haltung mit vielen Fragen, mit den richtigen Fragen, meine Mitarbeiter zu entwickeln. Das kann eine Führungskraft als Coach machen. Ein Coach von außen wird mit Sicherheit nochmal ein paar andere Elemente mit reinbringen. Ja, ich finde, im Punkt, den ich mit dem Spielfeldrand angesprochen habe, spannend. Also, man sieht es ja auch in der Champions League oder Bundesliga. Es wechselt sich ja selten einen Trainer selbst ein, um dann die Tore in der letzten Minuten noch zu schicken, weil sie so schön gesagt den Weg frei machen oder die Taktik oder die Möglichkeiten vorgeben, wie man das Tor dann entsprechend erzielt. Du hast über das „Warum“ gesprochen und meinst du damit, also warum bestimmte Aktivitäten wichtig sind, warum bestimmte Kompetenzen wichtig sind und dann den Mitarbeitenden die Freiheit geben, das war so ein Wiener weiter, einem auszuleben und auszufüllen oder mit Leben zu füllen. Und in dem zubefand ich deine Wortwahl wieder ganz spannend. Du hast gesagt, ich darf mich dann etwas zurücknehmen als Führungskraft. Ich glaube, in den Augen vieler Führungskräfte ist das eher ein „Ich muss mich jetzt zurücknehmen“. Wie krieg ich es denn hin, dass ich das wirklich von meinem Mindset herin, ich darf mich jetzt zurücknehmen und formulieren kann? Ja, ich denke, es sind zwei Punkte. Der erste Punkt ist der Einfachere. Ich darf mir meine Aufgabe bewusst werden. Und das bedeutet eben, dass ich nicht, um in deinem Beispiel zu bleiben, als Trainer aufs Spielfeld renne und das Tor selber versuche zu schießen, sondern dass ich es schaffe, die Mitarbeiter dahin zu entwickeln, dass sie das, was ich vielleicht könnte, vielleicht aber auch gar nicht so gut, multiplizieren können. Und das ist einfach eine andere Aufgabe, als wenn ich sage, meine Aufgabe ist es, aufs Spielfeld drauf zu gehen und mitzuspielen. Und wenn ich mir diese Aufgabe bewusst werde, kann mir das schon helfen. Und das kann ich mir auch aufschreiben und an den Rechen erhängen, um mich selber daran zu erinnern. Also hier wieder ein Prozess quasi. Sowieso, das Leben ist ein Prozess, wenn es nicht doch. Darüber hinaus ist wichtig Vertrauen. Und am Ende ist es jetzt ein bisschen psychologisch. Gegen Angst hilft Kontrolle und Vertrauen. Wenn ich als Führungskraft Angst habe, werde ich entweder versuchen mir Kontrolle zu erhalten oder ich schaffe es zu vertrauen. Und genau das ist dieses Dilemma. Wenn ich versuche, mir Kontrolle zu erhalten, um eigentlich gegen meine Angst oder vielleicht den Druck, den ich von oben erhalte zu wirken, dann versuche ich, im Zweifel mit drauf zu rennen und mit zu agieren. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch sagen, ah, ich merke diesen Impuls, dass ich am liebsten diese Aufgabe selber erledigen möchte, anstatt es meinen Mitarbeiter zuzutrauen. Und kann mich dann in dem Moment selber zurücknehmen und sagen, okay, ich sehe das jetzt als meine Aufgabe an, dieser Person zu vertrauen und mir selber zu vertrauen, dass ich sie dahin führen kann, dass sie fähig Aufgabe zu übernehmen. Jetzt gibt es ja auch Mitarbeitenden in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Also sind die Leute wirklich schon fähig, die Aufgabe zu übernehmen und auch gut zu erledigen. Ist ja auch eine Fragestellung, weil vielleicht habe ich die Mitarbeiter noch nicht an dem Stand, wo ich sie gerne hätte oder wo sie für die Aufgabe sein müssten. Wie gehe ich denn damit dieser Herausforderung um? Weil die Aktivität oder die Aufgabe muss ja dann trotzdem erledigt werden. Mal abgesehen davon, dass ich in meinem Team natürlich eine gewisse Diversität habe. Also wenn ich jetzt mein Team habe und ich habe nur juniorige Charaktere darin, dann wird es definitiv so sein, dass bei mir mehr landet. Aber wenn wir davon ausgehen, dass ich ein Team habe, was eben diese Diversität mitbringt. Und ich habe sowohl juniorigere als auch seniorige Personen in dem Team, dann darf ich mich auch hier wieder auf meine Aufgabe besinnen. Ich als Schulungscafé bin dafür verantwortlich, die Menschen zu entwickeln. Und das bedeutet, dass ich denjenigen, der vielleicht jetzt noch nicht kompetent ist, diese Aufgabe und diese Verantwortung zu übernehmen, es irgendwann schon ist. Und das wird die Person nicht sein, wenn ich ihr die Last oder die Verantwortung abnehme. Das heißt, wenn ich möchte, dass sich an diesem Zustand irgendwann was ändert und aus dieser Hilflosigkeit der Person heute eine Kompetenz in Zukunft wird, bedeutet das, dass ich nicht ihr die Verantwortung abnehmen darf, sondern sie dabei unterstütze, das sukzessive zu lernen. Das geht dann ein bisschen auch, wenn wir dann an den Prozess denken, dass man vielleicht so, dass die Feedback schleifen enger macht, dass man vielleicht stärker noch da ist, wird stärker auch anbietet, noch nach Rat zu fragen, vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Hinweis zu geben, um quasi diese Entwicklung zu beschleunigen, beziehungsweise so mal den Anschub zu geben, damit sich dann schneller auch weiterentwickeln kann. Wenn ich die Aufgabe dann erledigt habe, stopfe ich daraus, wenn man hoffentlich auch mal zu, auch wieder Motivation, mich wieder eine neuen Aufgabe, eine neue Herausforderung zu widmen. Ja, absolut. Also was feststeht ist, wenn ich das meine Mitarbeiter oder meiner Mitarbeiterin abnehme, dann wird sie das nicht lernen, diese Person. Das ist der sicherste Weg dafür zu sorgen, dass sich Menschen nicht entwickeln, indem ich ihnen die Herausforderung abnehme. Das heißt, meine Aufgabe ist es natürlich, dann enger an der Person dran zu bleiben, regelmäßig Feedback zu geben und zu nehmen, iterativ zu arbeiten, früh für kleine Erfolge zu sorgen, um die Selbstwirkksamkeit zu stärken. All das, was ich in diesem agilen Prozess mache, auch prozessualer Ebene, mache ich natürlich auch auf dem Prozess der Mitarbeiterinwicklung gemünzt. Was kannst du denn Führungskräften noch mitgeben? Was sind aus deiner Sicht die drei wichtigsten Dinge beim Coaching? Grundsätzlich die Beziehung. Also das zeigt auch die Forschung, die Beziehung zwischen dem Coachenden und dem Coachee ist das Wichtigste dafür, dass das Ganze gelingt. Wenn wir jetzt wirklich von einem Coaching-Prozess sprechen, im Sinne von wir definieren einen Prozess, wir starten hier, wir wollen da auskommen und nehmen uns da für die und die Zeit, dann sollten wir auch ganz gerade das Ziel definieren. Bei dem Beispiel, was wir gerade hatten, ein Mitarbeiter, der heute noch nicht fähig ist, diese Aufgabe zu übernehmen, mit dem definieren wir das Ziel, zu welchem Zeitpunkt er fähig ist, welche Aufgabe alleine zu übernehmen. Und dann grundsätzlich Offenheit dem gegenüber, was passiert. Denn vielleicht wird es so sein, dass der Mitarbeiter uns mit einem Problem kommt, wo wir denken, das ist doch kein Problem. Ist das dann ernst? Wir bewerben direkt oder neudeutschen, judging direkt. Und da ein bisschen aufzupassen und zu sagen, was die Person als Problem erlebt, ist ein Problem. Und wir bleiben einfach offen dem gegenüber, was diese Person uns mitbringt an Ideen, an Herausforderungen und reagieren darauf und arbeiten damit. Man spricht dir auch gerne vom systemischen Coaching. Und ich glaube, wenn man drei Leute fragt, was das denn ist, kriegt man vielleicht auch mindestens drei Antworten. Jetzt haben wir dich ja als Expertin hier. Hilf uns doch mal eine gute Definition zu geben. Was heißt denn eigentlich systemisches Coaching? Systemisches Coaching bedeutet erstmal, dass wir nicht nur den einzelnen Teil, der vielleicht ein Problem war, stellt, für eine Person betrachten, sondern das gesamte System. Man kann sich das so vorstellen, dass jeder von uns Teil mehrerer Systeme ist. Du bist in einem Familiensystem, du bist in einem Nachbarschaftssystem, du bist in einem beruflichen System, du hängst in vielen Systemen. Und dieses System ist immer wie so ein Mobilee, das was bei Babys oft über dem Bett hängt. Wenn ich an einem Ende ziehe, wackelt das ganze Mobilee mit. Das heißt, wenn sich in einem System an einer Stelle etwas ändert, hat das Auswirkungen auf alle anderen Teile dieses Systems. Und das ist der Gedanke, der hinter systemischem Coaching steht. Aus dieser Erklärung heraus sagt man auch, ich kann nur Coaching, wenn ich nicht Teil des Systems bin. Deshalb, ich als systemischer Coach auch ein Fragezeichen mache, ob eine Führungskraft wirklich Coach sagt an. Sie kann aber definitiv einzelne Coaching-Asthekte abbilden. Da glaube ich ganz fest daran. Es ist in dem Zusammenhang ja auch, dass taucht ja oftmals, wenn ich dann als Coach Feedback gebe, vielleicht eher zum Feedback und zum Reflektieren anleite. Das heißt, statt dem Markus Redemann zu sagen, du musst das jetzt so und so anders machen, eher Fragen stelle, sodass der Markus Redemann selbst auf die Idee kommt. Was könnte man denn noch anders machen? Was könnte man denn verbessern? Wie ordnest du das ein? Ist das einfach unsätzlich eine Coaching-Kompetenz? Gehört das mit zum systemischen Coaching? Wie siehst du das? Die richtigen Fragen zu stellen, ist definitiv Coaching-Kompetenz. Und das gehört auch zu den Dingen, wo ich sage, das kann auch eine Führungskraft tun. Also fernab von dieser Diskussion kann eine Führungskraft Coach sein. Ich glaube, viele Fragen zu stellen, ist der einzige Weg, die Menschen in die Entwicklung zu bringen. Wenn ich jemanden coache, ist mein höchstes Ziel, eigentlich, dass die Person in die Selbstreflektion kommt. Denn jemand, der stark selbstreflektiert ist, entwickelt sich vollautomatisch. Wenn ich in einer herausfordernden Situation stehe und das gelingt mir, die Situation zu reflektieren, selber auf die Meta-Ebene zu gehen, das Ganze von außen zu betrachten und dann zu schauen, was hat gut geklappt, was waren die Ursachen, dass sie das Dinge nicht gut geklappt haben, dann habe ich kein Problem mehr, dann passiert Entwicklung vollautomatisch. Das heißt, wenn ich in einer coachenden Rolle bin, dann wird es meine Kernaufgabe sein, die Person zu spiegeln oder der Person den Spiegel vorzuhalten und sie dabei zu unterstützen, dass sie in die Reflexion kommt, um sich daraus zu entwickeln. In unserem Projekten erleben wir immer häufiger, dass Führungskräfte beim Thema Coaching sein, ja, ist wichtig, doch dann kommt das Thema Dringlichkeit. Also die klassische Vertriebshektik greift dann um sich, auch das Thema Führungsspannen. Wenn ich dann Teams hab mit 12, 14, 15 Mitarbeitenden, das wird schwer, da regelmäßig und konsequent dann auch zu coaching. Und irgendwie weit kann denn hier KI eine Rolle spielen. Das heißt, man simuliert zum Beispiel ein Verkaufsgespräch am Rechner, dann kann eine KI analysieren, wie habe ich denn das Verkaufsgespräch geführt, also Stimme, Blickkontakt, Tonfall, aber auch Struktur, Inhalt. Kann hier KI tatsächlich die Führungskräfte entlasten und somit auch das Vertriebsteam darüber weiterentwickeln? Also zum einen führe ich gerade selber 14 Mitarbeiter und lasse die Ausrede nicht gelten, dass das bei dieser Teamgröße nicht gelingt, da glaube ich nicht dran. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass KI uns ganz wundern kann. Vielleicht dann aus der Perspektive mehr als Trainer als als Coach, aber darüber lässt sich streiten. Also sei es, dass wir echte Konversationen aufzeichnen und dann individuell uns Feedback dazu geben lassen, ist mit Sicherheit eine ganz wunderbare Möglichkeit, sofern wir die Zustimmung der anderen Person dazu haben. Was auch spannend ist, ist, wenn wir die KI einsetzen als simulierter Kunde, beispielsweise, und dann eben jemanden haben, einen Kunden haben, der sehr viel Geduld mit uns hat, wo wir sehr viele Ansätze testen können, sehr viel Feedback generieren und dadurch auch eine sehr steile Lernkurve erreichen, kann mit Sicherheit ein wunderbarer Input sein oder eine wunderbare Maßnahme sein. Das können wir auch gamifizieren, dass wir wirklich das so ein bisschen spielerisch erreichen, dass unsere Mitarbeiter einfach bereit sind mit einem simulierten Kunden, wo ich nichts kaputt machen kann, zu üben und dann schnell Feedback einzuholen. Als Führungskraft kann ich auch mit einem simulierten Mitarbeiter sprechen. Dann geht die KI in die Rolle eines Mitarbeiters und ich kann irgendwie das schwierige Mitarbeitergespräch vielleicht führen kann. Kann auch meine Coaching-Kompetenz in einem simulierten Gespräch testen und mir dazu Feedback geben lassen. Nicht zuletzt, um das Ganze wieder in Struktur zu gießen und nicht im Chaos versickern zu lassen, hilft uns die KI natürlich auch dabei individuelle Lehrpläne für die Mitarbeiter zu entwickeln und zu schauen, wer hat eigentlich wo Entwicklungspotenzial, wo liegen die Entwicklungsfelder, wie kann ich da bestmöglich unterstützen. Also ich glaube, dass wir KI einsetzen bei allem, was wir heute tun, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Ich glaube, der Charme liegt vor allem darin, dass ich mal ausprobieren kann. Dass ich mal mutig sein kann, was ausprobieren kann, schauen, wie es wirkt und mir darüber dann auch Sicherheit aneignen kann, die ich so im Kundengespräch vielleicht nicht hinbekomme, weil ich mich noch nicht vollends traue, alles, was ich vielleicht in einem Workshop, in einem e-Learning oder ähnliches gelernt habe, dann auch zu testen und auszuprobieren. Und so kann ich natürlich auch Sicherheit gewinnen in einem geschützten Raum, weil es sind ja quasi nur die KI und ich jetzt gerade da und testen das Kundengespräch oder das Mitarbeitergespräch oder das Coachinggespräch dabei. Das ist der Liner für diese wertvollen Informationen rund um Agilität und auch Coaching. Persönlich nehme zum einen mit, dass Kinderzimmer für strukturiertes Chaos stehen können. Ich nehme weiterhin noch mit, dass beim Thema Agilität es sehr stark um Anpassungsfähigkeit geht und damit auch schnelles Feedback wichtig ist. Und damit sind wir ja auch bei den Führungskräften, dass man auch den Mut hat auf beiden Seiten, sowohl auf der Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie auch bei den Führungskräften, dass man auch aus den Fehlern lernt und dass Führungsspanne nicht unbedingt die Ausrede ist, um Coaching hinten runterfallen zu lassen. Zeig dich, dass das durchaus geht. Es hat einfach was mit Prioritäten und Priorisierung zu tun. So habe ich das verstanden. Und zwar sich noch gerne mitnehmen, ist Kundenwissen steht über Produktwissen. Also, dass es wirklich darum geht, sich intensiv in den Kunden hineinzudenken und da meine Kompetenz auch als Vertriebler dann auch wirklich leben zu können und auch dort einen guten Nutzen zu bringen, indem ich dann immer mehr Werte für den Kunden auch schaffen kann. Wenn ihr die Behörerinnen und Hörer Lust auf die weiteren Podcast jetzt mit Alina bekommen habt, die wir bereits in der Vergangenheit aufgenommen und veröffentlicht haben, oder euch das Thema „Sales Excellence“ mehr interessiert, oder ihr auch gerne die Studie über, die wir ganz am Anfang gesprochen haben, anschauen wollt, dann schaut gerne auf unsere Homepage, mercury.de mit C und I. Nicht vergessen. Und dann in der Rubrik „News & Insights“ findet ihr dann weitere Podcasts, die Studien oder auch weitere White Paper. Und nicht vergessen, weiterhin mutig bleiben. [Musik